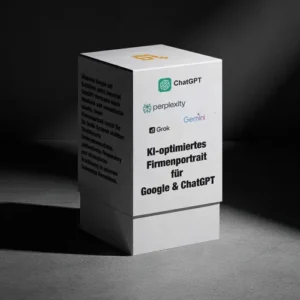Hohe und schwankende Energiepreise beschäftigen Schweizer KMU seit 2022 wie selten zuvor. Ob Bäckerei, Metallbau, Druckerei, Hotel oder Kühl- und Logistikbetrieb: Wenn Strom- und Wärmekosten steigen, schrumpfen Margen – und Planbarkeit leidet. Gleichzeitig verlangen Kundinnen und Kunden sowie öffentliche Auftraggeber zunehmend energieeffiziente und klimafreundliche Prozesse.
Die gute Nachricht: Auch in einem volatilen Markt lassen sich Energiekosten mit pragmatischen Schritten spürbar senken – sofort, mittelfristig und strategisch langfristig. In diesem Leitfaden erhalten Sie einen praxisnahen Überblick zur aktuellen Preisentwicklung in der Schweiz, konkreten Sofortmassnahmen, Investitionsentscheidungen mit Köpfchen, Fördergeldern für KMU, alternativen Energiequellen, Digitalisierung und Mitarbeitersensibilisierung – abgerundet durch eine langfristige Energiestrategie für Ihr Unternehmen.
Alle Beispiele sind auf die Schweiz zugeschnitten, nennen typische Budgets in CHF und zeigen, wie Sie mit wenig Zeitaufwand starten. Und wenn Sie passende Fachbetriebe, Energieberater oder Solarteure in Ihrer Region suchen: Auf firmafinden.ch finden Sie verlässliche Schweizer Anbieter – transparent und lokal.
Aktuelle Energiepreisentwicklung in der Schweiz: Was KMU wissen müssen
Die Schweizer Strommärkte sind seit 2022 deutlich volatiler. Zwar hat sich die Lage gegenüber den Höchstständen entspannt, dennoch liegen die Endkundenpreise im Schnitt weiterhin über dem Niveau von 2020/2021. Mehrere Faktoren wirken zusammen:
- Beschaffungskosten: Marktpreise an europäischen Börsen, Wasserkraftverfügbarkeit, und die Import-/Exportlage beeinflussen die Energiekomponente.
- Netznutzung und Abgaben: Je nach Netzgebiet variieren Tarife deutlich; für Unternehmen machen Netz- und Abgabenanteile oft 40–60% der Stromrechnung aus.
- Vertragsmodell: KMU mit Jahresverbrauch über ca. 100 MWh sind häufig im freien Markt und damit stärker exponiert. Kleinere KMU sind meist in der Grundversorgung mit regulierten Tarifen.
Laut ElCom (Eidgenössische Elektrizitätskommission) zeigen sich in vielen Netzgebieten 2024/2025 zwar erste Entspannungstendenzen bei der Energiekomponente, aber das gesamtwirtschaftliche Niveau bleibt erhöht. Für einzelne Branchen mit hohem Lastspitzenanteil (z. B. Metallverarbeitung, Kälte/Klima) sind insbesondere Leistungs- und Arbeitspreise sowie die Lastgangstruktur entscheidend.
Was bedeutet das für KMU konkret?
- Transparenz über den eigenen Lastgang ist Gold wert. Wer seine Spitzen kennt, kann sie gezielt glätten.
- Tarifoptimierung (z. B. Verschiebung in Niedertarifzeiten) spart schnell im 1–2-stelligen Prozentbereich – ohne grosse Investitionen.
- Diversifikation der Energiequellen (Eigenverbrauch PV, Wärmepumpe, Fernwärme) und längerfristige Beschaffungsstrategien erhöhen Planbarkeit.
Quellen und weiterführende Informationen: ElCom (elcom.admin.ch), Bundesamt für Energie BFE (bfe.admin.ch), Swissgrid Marktberichte (swissgrid.ch), EnergieSchweiz (energieschweiz.ch).
Sofortmassnahmen zur Kostensenkung: 0–90 Tage
Diese Massnahmen sind kurzfristig umsetzbar, erfordern wenig Budget und liefern schnell messbare Effekte.
1) Lastspitzen glätten (Peak Shaving)
- Was tun? Lastprofile (15-Minuten-Werte) vom Netzbetreiber einfordern und analysieren. Verbraucher mit hohem Anlaufstrom (Kompressoren, Lüftungen, Kälte) zeitlich staffeln.
- Tools: Einfache Zeitschaltprogramme oder intelligente Relais (ab CHF 200–1’500), EMS-Startlösungen (ab CHF 2’000–8’000).
- Ergebnis: 5–20% weniger Leistungsspitzenkosten je nach Betrieb. Amortisation oft < 12 Monate.
2) Niedertarif nutzen und Prozesse verschieben
- Was tun? Wasch-/Spülprozesse, E-Mobilitätsladen, Warmwassererzeugung, Kälte-Recycling in NT-Zeiten fahren.
- Budget: Anpassungen der Steuerung/Programmierung meist CHF 500–3’000.
- Tipp: Mit dem Lieferanten klären, welche NT-Zeitfenster im Netzgebiet gelten.
3) Beleuchtung: LED und Sensorik
- Massnahme: Austausch T8/T5/HI-Lampen auf LED, Präsenz-/Tageslichtsensoren in Fluren, Lagern, Parkhäusern.
- Budget: CHF 5’000–50’000 je nach Fläche; Fördermittel möglich (ProKilowatt/kantonal).
- Ergebnis: 50–70% weniger Strom für Licht. ROI häufig 1–3 Jahre.
4) Druckluft: Leckagejagd
- Massnahme: Leckagen orten (z. B. Ultraschall, ab CHF 500 Messung) und abdichten; Druckniveau um 0.5 bar senken, wenn möglich.
- Ergebnis: 10–30% Einsparung bei Druckluft – oft in Wochen amortisiert.
5) Temperatur- und Lüftungs-Feintuning
- Massnahme: Raumtemperatur in Büros auf 20–21°C, Lager 16–18°C; Nachtabsenkung; Lüftungszeiten an Belegung anpassen.
- Hinweis: Arbeitsrechtliche und gesundheitliche Vorgaben beachten; Komfortbereiche einhalten.
6) Standby- und Kleingeräte-Management
- Massnahme: Schaltbare Steckdosen (z. B. CH-T13), Ausschaltlisten für Feierabend/Wochenende.
- Ergebnis: 2–5% Gesamtstrom – schnell realisierbar.
7) Liefer- und Wartungsverträge prüfen
- Stromlieferung: Preiskomponenten verstehen, Absicherung prüfen, Offerten vergleichen.
- Wartung: Regelmässige Wartung senkt Energieverbrauch (z. B. Kälteanlagen, Brenner, Drucklufttrockner).
Sofort-Checkliste (30–60 Minuten Startaufwand)
- Letzte 12 Monate Stromrechnung und Lastgangdaten besorgen
- Top-5 Verbraucher identifizieren (Schätzung reicht fürs Erste)
- Zeitschalt-/Sensorik-Potenziale notieren
- Wöchentliche Abschaltliste definieren (Verantwortliche benennen)
- Offerten für LED und Leckageprüfung einholen (3 Anbieter)
- Beratung/Analyse-Angebote über firmafinden.ch vergleichen
Investitionen in Energieeffizienz bewerten: So rechnen KMU richtig
Kluge Effizienz-Investitionen senken dauerhaft Kosten und Risiken. Entscheidend ist eine transparente Bewertung: nicht nur Anschaffungspreis, sondern Lebenszyklus und Risikoabsicherung.
Die wichtigsten Kennzahlen
- Amortisationszeit = Investition / jährliche Nettoersparnis (Ziel: oft 2–5 Jahre)
- Kapitalwert (NPV): heutiger Wert aller Zahlungsströme (rentabel, wenn NPV > 0)
- Interne Verzinsung (IRR): Rendite der Investition (Benchmark: Kapitalkosten + Risikoaufschlag)
- TCO (Total Cost of Ownership): Anschaffung + Betrieb/Wartung + Energie + Entsorgung
Beispiel 1: LED-Umrüstung in einer Werkhalle
- Ausgangslage: 150 Leuchten, 10 Stunden/Tag, 250 Tage/Jahr. Alt: 150 W, Neu: 60 W.
- Investition: CHF 38’000 (Material/Montage), Förderung CHF 7’500 → Netto CHF 30’500.
- Einsparung: (150 W – 60 W) x 150 Leuchten x 2’500 h = 33’750 kWh/Jahr. Bei 0.20 CHF/kWh ≈ CHF 6’750/Jahr.
- Wartung: Zusatzersparnis CHF 800/Jahr.
- Amortisation: 30’500 / (6’750 + 800) ≈ 4.1 Jahre. Lebensdauer 10–12 Jahre → attraktiv.
Beispiel 2: Druckluft-Kompressor mit Wärmerückgewinnung
- Investition: CHF 45’000 (inkl. Wärmerückgewinnung), Förderung CHF 9’000 → Netto CHF 36’000.
- Einsparung Strom: CHF 5’500/Jahr; Wärmeersatz (Gas) CHF 2’400/Jahr.
- Amortisation: 36’000 / 7’900 ≈ 4.6 Jahre; deutlicher Komfortgewinn im Winter.
Typische Stolpersteine
- Nur CAPEX betrachten, OPEX und Energiepreise ignorieren
- Fördergelder zu spät prüfen (vor Projektstart beantragen!)
- INSTANDHALTUNG unterschätzen (Reinigung, Filter, Sensoren)
- Produktionsrisiken/Stillstand nicht einpreisen
Tipp: Nutzen Sie einfache Excel-Templates für NPV/IRR oder fragen Sie Ihren Energieberater. Über firmafinden.ch finden Sie qualifizierte Partner aus Ihrer Region, die eine neutrale Bewertung vornehmen.
Förderprogramme für KMU in der Schweiz: Geld nicht liegen lassen
Die Schweiz unterstützt Effizienz und erneuerbare Energien mit verschiedenen Programmen. Wichtig: Fristen und Vorbedingungen beachten – meist muss der Antrag vor Investitionsentscheid eingereicht werden.
Bundesprogramme und nationale Angebote
- ProKilowatt (BFE): Förderbeiträge für Projekte mit deutlicher Stromeinsparung (z. B. Beleuchtung, Kälte, Motoren, Druckluft). Beitragsquoten typischerweise 20–30% der Investitionskosten. Info: prokilowatt.ch
- EnergieSchweiz: Programme, Beratungschecks, Pilot-/Demoprojekte, branchenspezifische Leitfäden. Info: energieschweiz.ch
- EnAW – Energie-Agentur der Wirtschaft: Zielvereinbarungen, Coaching und Monitoring – besonders für energieintensive Betriebe attraktiv. Info: enaw.ch
Kantonale und kommunale Förderungen
- Kanton Zürich, Bern, Basel-Stadt, St. Gallen, Waadt, Genf u. a. unterstützen PV, Speicher, Wärmepumpen, Gebäudetechnik und Energieberatung. Prüfen Sie das kantonale Programm (z. B. Energie-Förderprogramme der Baudirektionen) und kommunale Zusatzbeiträge (z. B. Stadtwerke, Elektrizitätswerke).
- Fernwärmeanschlüsse werden regional gefördert, insbesondere in Städten und Agglomerationen (z. B. Zürich, Basel, Bern, Lausanne, Genf).
So gehen KMU vor (Schritt-für-Schritt)
- Massnahme definieren (z. B. LED, Kompressor, Kälteanlage, PV)
- Einsparpotenzial grob berechnen (Angebot mit Energieeinsparung anfordern)
- Passende Förderprogramme prüfen (Bund/Kanton/Gemeinde)
- Antrag mit Offerten einreichen (vor Abschluss des Kaufvertrags)
- Zusage abwarten – dann Umsetzung starten
- Nachweis führen (Inbetriebnahme, Messprotokolle, Rechnungen)
Hinweis: Förderlandschaft kann sich ändern; aktuelle Richtlinien und Fristen stets auf den offiziellen Seiten prüfen. Ein erfahrener Energieberater – den Sie z. B. über firmafinden.ch finden – kennt die kantonalen Besonderheiten.
Alternative Energiequellen für Betriebe: Unabhängiger und berechenbarer
Photovoltaik (PV) mit Eigenverbrauch
- Vorteile: Senkt Strombezug tagsüber, hohe Planungssicherheit, positive Wirkung auf Nachhaltigkeit und Kundenwahrnehmung.
- Wirtschaftlichkeit: Bei Gewerbedächern oft attraktiv, wenn 30–70% Eigenverbrauch erreicht werden. Preise für schlüsselfertige Anlagen: ca. CHF 900–1’400/kWp (Richtwert; je nach Grösse/Statik).
- Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV): Mehrere Mieter/Betriebe teilen PV-Strom – interessant für Gewerbeareale.
- Finanzierungsmodelle: Kauf, Leasing, Contracting, PPA (Stromabnahmevertrag über 10–15 Jahre).
Wärmepumpen und Abwärmenutzung
- Wärmepumpen (Luft/Wasser, Wasser/Wasser) in Kombination mit PV und Lastmanagement reduzieren Heizkosten und CO₂.
- Abwärme aus Kälte-/Druckluftanlagen kann Warmwasser und Heizung unterstützen.
Fernwärme und Biomasse
- Fernwärme: In Städten/Kantonen mit Ausbauplänen (z. B. Zürich, Basel) eine stabile Alternative zu Gas/Öl.
- Biomasse/Hackschnitzel: Für ländliche Betriebe mit Platz und hohem Wärmebedarf interessant; Brennstoffpreise oft stabiler.
Elektrische Mobilität und Ladeinfrastruktur
- Fuhrpark elektrifizieren, kombiniert mit PV-Überschussladen; gesteuertes Laden glättet Lastspitzen.
- Förderungen für Ladepunkte sind regional verfügbar; Tarife für Mitarbeitende/Öffentlichkeit klar regeln.
Digitalisierung: Daten senken die Stromkosten
Ohne Messung keine Steuerung. Digitale Tools machen Verbrauch transparent und ermöglichen automatisches Sparen.
Bausteine eines digitalen Energiemanagements (EMS)
- Submetering: Zähler auf Anlagen-/Bereichsebene für Strom, Wärme, Kälte, Druckluft.
- Sensorik: Temperatur, Feuchte, Türen/Tore, Leistungsmessung.
- Dashboard: Visualisierung (Web/App) mit Alarmschwellen.
- Automatisierung: Regeln für Lastmanagement (z. B. „wenn PV > 50 kW, Ladepunkte aktivieren“).
- Standards: ISO 50001 als Rahmen, falls sinnvoll; für KMU reichen oft leichtere EMS-Setups.
Tool- und Anbieter-Beispiele (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
- IoT-Steckdosen und Unterzähler (CH-kompatibel): schneller Einstieg, CHF 50–500 je Messpunkt.
- Cloud-EMS: Monatliche Lizenz CHF 50–500, je nach Umfang/Anzahl Messpunkte.
- Lastmanagement-Controller: Einmalig CHF 2’000–10’000, je nach Komplexität und Integration.
Pro: schnelle Transparenz, Alarme, Automatisierung. Contra: Integration in bestehende Anlagen, Datensicherheit beachten.
Datenschutz (Schweiz): Betriebsdaten sind in der Regel keine Personendaten. Wo Mitarbeitendenbezug möglich ist (z. B. Einzelschichtprofile), revDSG beachten, Transparenz schaffen und Zugriffsrechte regeln.
Tipp: Auf firmafinden.ch finden Sie Systemintegratoren und Energie-Dienstleister, die EMS-Lösungen pragmatisch aufsetzen – inklusive Monitoring und Service.
Mitarbeiter-Sensibilisierung: Energie sparen als Teamleistung
Technik spart viel – Menschen oft mehr. Mit einem klaren, respektvollen Programm aktivieren Sie das Wissen Ihrer Mitarbeitenden.
4‑Wochen‑Kickstart für KMU
- Woche 1: Kurzschulung (30 Min, DE/FR/IT, je nach Standort), Ziele kommunizieren (z. B. „−10% Strom in 6 Monaten“), Ideenbox eröffnen.
- Woche 2: Poster/Sticker an Anlagen („Bitte abschalten“, „Türen schliessen“), Verantwortliche pro Bereich ernennen.
- Woche 3: Begehung mit Team: Leckagen, Licht, Lüftung, Standby, Temperatur – Massnahmenliste ableiten.
- Woche 4: Quick-Wins umsetzen, Erfolg feiern (z. B. Kaffee-Gutschein) und monatliches Update etablieren.
Incentives: Kleine Prämien für beste Teams, monatliche „Energie-Champions“, Ideenprämie CHF 50–200 für umgesetzte Vorschläge.
Mehrsprachigkeit: In gemischten Teams Materialien in DE/FR/IT bereitstellen; Piktogramme nutzen.
Langfristige Energiestrategie entwickeln: Von reaktiv zu proaktiv
Eine strukturierte Energiestrategie macht Ihr Unternehmen resilient – gegenüber Preisvolatilität, Lieferkettenrisiken und Regulierung. So bauen Sie die Strategie auf:
1) Ausgangslage und Ziele
- Ist-Analyse: Energierechnung, Lastgänge, Top-10-Verbraucher, CO₂-Fussabdruck (Scope 1–3 so weit sinnvoll).
- Ziele: z. B. −25% kWh/Output bis 2028, 60% Eigenstrom, NetZero-Plan bis 2040.
2) Massnahmen-Roadmap
- Quick Wins (0–12 Monate): Lastmanagement, LED, Leckagen, Regelung.
- Midterm (1–3 Jahre): Kälte-/Wärme-Optimierung, PV, Wärmepumpe, Gebäudehülle.
- Longterm (3–10 Jahre): Prozesswärme-Dekarbonisierung, Speicher, PPA/Contracting, ISO 50001.
3) Beschaffungs- und Absicherungsstrategie
- Lieferverträge: Mix aus Festpreis- und Tranchenmodellen; PPA prüfen.
- Eigenproduktion: PV auf Dach/Fassade, ZEV im Areal.
- Versicherung/Absicherung: Preisschwankungen und Ausfälle in der Risikomatrix abbilden.
4) Organisation und Monitoring
- Verantwortung: Energie-Owner im Betrieb benennen (Technik/Finanzen gemeinsam).
- KPIs: kWh/Produktionseinheit, kW-Spitzen, CHF/kWh, CO₂/kWh.
- Review: Quartalsweise Management-Review, jährlicher Reifegrad-Check.
Case Studies aus der Schweiz: Praxisbeispiele mit Zahlen
Case 1: Bäckerei Meier AG (Aargau) – Backen mit weniger Spitzen
- Ausgangslage: 35 Mitarbeitende, hoher Nachtbetrieb, Leistungsspitzen 120 kW, Jahresverbrauch 420’000 kWh, Grundversorgungstarif mit Leistungskomponente.
- Massnahmen:
- Lastmanagement für Öfen/Kälte (Controller, CHF 6’800)
- LED-Umrüstung Verkaufs- und Produktionsbereich (CHF 18’500, Förderung CHF 3’000)
- Schulung: Abschaltliste, Türen/Tore konsequent schliessen
- Ergebnisse nach 6 Monaten:
- Leistungsspitzen von 120 kW auf 96 kW (−20%)
- Stromverbrauch −9% (≈ −37’800 kWh)
- Kosteneinsparung: ca. CHF 11’200/Jahr
- Amortisation gesamt: 2.1 Jahre
- Lektion: Lastmanagement + Mitarbeitende = schnelle Wirkung ohne Produktionsrisiko.
Case 2: Metallbau Romandie SA (Fribourg) – PV, Kompressor, Wärmerückgewinnung
- Ausgangslage: 65 Mitarbeitende, Schichtbetrieb, 1’100’000 kWh/Jahr, freier Markt.
- Massnahmen:
- PV 250 kWp (CHF 275’000, Contracting-Modell)
- Neuer Kompressor mit Wärmerückgewinnung (Netto CHF 36’000 nach Förderung)
- EMS mit Submetern (CHF 12’000, inkl. 30 Messpunkte)
- Ergebnisse nach 12 Monaten:
- Eigenverbrauch PV 62% → Netzbezug −155’000 kWh
- Kompressor Strom −14%, Wärmeersatz Gas −20 MWh
- Gesamteinsparung ca. CHF 58’000/Jahr
- PPA-Preis fixiert → Budgetstabilität bis 2038
- Lektion: Kombination aus Erzeugung, Effizienz und Daten schafft sowohl Kosten- als auch Planungsvorteile.
Checklisten und Schritt-für-Schritt-Anleitungen
90‑Tage‑Plan für energieintensive KMU
- Tag 1–7: Daten sichern (Rechnungen, Lastgang), Quick-Wins identifizieren, Verantwortliche benennen.
- Tag 8–21: LED-/Leckage-Offerten einholen; NT-Verschiebungen konfigurieren; Abschaltliste einführen.
- Tag 22–45: Lastmanagement-Pilot auf 2–3 Grossverbrauchern; Mitarbeiterschulung; Förderanträge vorbereiten.
- Tag 46–75: Umrüstung Licht/Druckluft; EMS-Basissetup installieren.
- Tag 76–90: Ergebnisse prüfen; Roadmap 12–36 Monate verabschieden (PV, Wärmepumpe, Kälteoptimierung).
Budgetleitfaden (Richtwerte, exkl. MwSt.)
- LED-Umrüstung KMU: CHF 5’000–80’000 (Förderung möglich)
- Leckage-Suche/Behebung: CHF 500–5’000
- EMS-Startpaket: CHF 2’000–12’000 + Lizenzen/Jahr CHF 600–6’000
- Lastmanagement-Controller: CHF 2’000–10’000
- PV 100–500 kWp: ca. CHF 100’000–650’000 (Kauf) oder PPA/Contracting ohne CAPEX
- Wärmepumpe Gewerbe: CHF 30’000–150’000 (stark anwendungsspezifisch)
Tool-Empfehlungen auswählen (Pro/Contra abwägen)
- Einfaches Submetering: Pro – schnell, günstig; Contra – begrenzte Tiefe.
- Cloud-EMS: Pro – Visualisierung, Alarme; Contra – Abo-Kosten, Integration.
- Individuelles Lastmanagement: Pro – hohe Einsparungen; Contra – Engineering-Aufwand.
- PPA/Contracting: Pro – planbare Kosten; Contra – Vertragsbindung, Bonitätsprüfung.
Häufige Fragen (FAQ) aus der Praxis
Wie finde ich seriöse Anbieter und vermeide Fehlinvestitionen?
Holen Sie mindestens drei Offerten ein, verlangen Sie Referenzen aus Ihrer Region und lassen Sie Einsparungen plausibel berechnen. Über firmafinden.ch können Sie gezielt nach geprüften Schweizer Fachbetrieben suchen und Bewertungen vergleichen.
Lohnt sich PV trotz Winterlast und Schlechtwetter?
Meist ja – wenn tagsüber Grundlast vorhanden ist. Eigenverbrauch ist der Hebel. Speicher kann helfen, ist aber nicht immer notwendig. Prüfen Sie ZEV/PPA-Modelle bei schwankendem Eigenverbrauch.
Soll ich ISO 50001 einführen?
Für grosse energieintensive Betriebe sinnvoll (Kostentransparenz, Prozesse, Zugang zu Programmen). Für kleinere KMU reicht oft ein schlankes EMS mit klaren KPIs und Verantwortlichkeiten.
Rechtliche Hinweise und Standards (Schweizer Kontext)
- Beschaffung/Verträge: Achten Sie auf Transparenz der Preisbestandteile (Energie, Netz, Abgaben). Bei PPA/Contracting rechtliche Prüfung vor Unterzeichnung.
- Arbeitssicherheit: Temperatur- und Lüftungsanpassungen im Rahmen der Arbeitsschutzvorgaben umsetzen.
- Datenschutz: Bei personenbezogen interpretierbaren Energiedaten revDSG beachten; Zugriffsrechte, Aufbewahrung, Transparenz regeln.
Dieser Artikel bietet keine Rechtsberatung; bei spezifischen Fragen wenden Sie sich an Fachjuristen oder Branchenverbände.
Interne Verlinkungen und weiterführende Themen
- PV und Eigenverbrauch im Gewerbe: Planung, ZEV und PPA – Praxisleitfaden
- Digitales Energiemanagement für KMU: Messkonzept, Tools, KPIs
- Fördergelder in den Kantonen: So nutzen KMU den Förderdschungel
Tipp: Viele dieser Themen finden Sie als Ratgeber bei firmafinden.ch – inklusive Checklisten und Anbieterübersichten.
Fazit: Heute starten, morgen sparen – und langfristig gewinnen
Die Energiekrise zwingt Schweizer KMU nicht in die Passivität – im Gegenteil. Wer jetzt Transparenz schafft, Sofortmassnahmen umsetzt und eine klare Roadmap verfolgt, senkt seine Kosten nachhaltig, stabilisiert Budgets und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit. Die Kombination aus Lastmanagement, Effizienz, Fördergeldern, Eigenproduktion und Mitarbeitendenengagement bringt rasch spürbare Resultate.
Setzen Sie die ersten Schritte in den nächsten 30 Tagen um und planen Sie die grossen Hebel über 12–36 Monate. Nutzen Sie Förderprogramme und holen Sie Angebote mehrerer Schweizer Anbieter ein. Und wenn Sie dabei Zeit sparen möchten: Auf firmafinden.ch finden Sie passende Fachbetriebe, Energieberater und Solarteure aus Ihrer Region – transparent, lokal und vergleichbar.
CTA: Mehr Sichtbarkeit und starke Partner für Ihr KMU
Finden Sie geprüfte Energie-Experten in Ihrer Nähe und präsentieren Sie Ihr Unternehmen dort, wo Schweizer Firmen suchen.