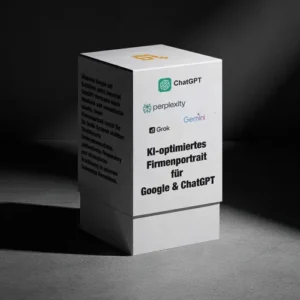Die Installation von Solaranlagen wird in der Schweiz immer beliebter. Warum? Steigende Strompreise, attraktive Förderungen und ein wachsendes Bewusstsein für erneuerbare Energien machen Photovoltaik zu einer überzeugenden Wahl. Moderne Module sind effizient, langlebig und bieten eine gute Möglichkeit, Stromkosten zu senken. Doch wie planst du die richtige Anlage für dein Zuhause oder Unternehmen? Hier sind die wichtigsten Punkte:
- Sonneneinstrahlung in der Schweiz: Je nach Region zwischen 1’100 und 1’400 kWh/m² jährlich.
- Förderprogramme: Bundesweite Einmalvergütungen und kantonale Zuschüsse reduzieren die Investitionskosten.
- Amortisation: Solaranlagen zahlen sich oft in 10–15 Jahren aus.
- Anlagengrösse: Abhängig vom Stromverbrauch – durchschnittlich 6 kWp für ein Einfamilienhaus mit 6’000 kWh Jahresverbrauch.
- Dachfläche: Etwa 6–8 m² pro kWp erforderlich, abhängig von Verschattung und Ausrichtung.
Ob Ziegeldach, Flachdach oder Schieferdach – die Planung muss auf die baulichen und rechtlichen Gegebenheiten abgestimmt sein. Zertifizierte Fachkräfte sorgen für eine sichere und effiziente Installation. Lies weiter, um alle Details zu erfahren, von der Berechnung der Anlagengrösse bis zur Auswahl der richtigen Komponenten.
[Praxis] PV-Anlagen schneller planen mithilfe von Google Earth Pro & PV*SOL premium (3D – Schweiz)
Energiebedarf und Anlagengrösse berechnen
Der erste Schritt bei der Planung einer Photovoltaikanlage ist die Analyse des Stromverbrauchs. Nur wer seinen Energiebedarf genau kennt, kann eine Anlage so gestalten, dass sie sowohl wirtschaftlich sinnvoll arbeitet als auch den verfügbaren Platz optimal nutzt.
Jahresverbrauch ermitteln
Um den jährlichen Stromverbrauch zu ermitteln, sollten Sie die Stromrechnungen der letzten 12 Monate überprüfen oder den Verbrauch direkt über die Zählerstände berechnen. Teilen Sie den Gesamtverbrauch in Kilowattstunden (kWh) durch 12, um den monatlichen Durchschnitt zu erhalten.
Ein durchschnittlicher Schweizer Haushalt verbraucht etwa 4’500 kWh pro Jahr bei einer Wohnfläche von rund 100 m². Ein Einfamilienhaus, das mit einer Wärmepumpe und einem Elektroboiler ausgestattet ist, benötigt hingegen zwischen 8’000 und 12’000 kWh jährlich. Kleine und mittlere Unternehmen liegen oft im Bereich von 15’000 bis 50’000 kWh pro Jahr.
Vergessen Sie nicht, zukünftige Veränderungen im Stromverbrauch zu berücksichtigen. Eine Wärmepumpe kann den Verbrauch um 3’000 bis 6’000 kWh pro Jahr erhöhen, während ein Elektroauto mit einer jährlichen Fahrleistung von 15’000 km etwa 2’500 kWh zusätzlich benötigt. Diese Werte helfen Ihnen, den Gesamtverbrauch und damit auch die benötigte Anlagengrösse zu berechnen.
Erforderliche Anlagengrösse bestimmen
Die benötigte Leistung Ihrer Photovoltaikanlage wird in Kilowatt peak (kWp) angegeben. Eine optimal ausgerichtete Anlage erzeugt in der Schweiz pro Jahr durchschnittlich 1’000 kWh pro kWp im Mittelland und bis zu 1’200 kWh pro kWp in südlichen oder höher gelegenen Regionen.
Die Berechnung erfolgt mit der Formel:
Anlagenleistung (kWp) = Jahresverbrauch (kWh) ÷ spezifischer Ertrag (kWh/kWp).
Ein Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 6’000 kWh benötigt also eine Anlage von etwa 6 kWp.
Typische Haushalte ohne Batteriespeicher nutzen etwa 25 % bis 35 % der erzeugten Energie direkt. Um die Wirtschaftlichkeit zu steigern, sollte die Anlage so dimensioniert werden, dass der Eigenverbrauch maximiert wird. Eine Anlage mit 4 bis 6 kWp kann etwa 30 % bis 40 % des Jahresverbrauchs durch Eigenverbrauch decken. Mit einem Batteriespeicher kann dieser Anteil auf 60 % bis 80 % steigen.
Neben der Leistung spielt auch der verfügbare Platz eine entscheidende Rolle bei der Planung.
Dachfläche und verfügbarer Platz
Die verfügbare Dachfläche ist oft ein begrenzender Faktor. Moderne Photovoltaikmodule benötigen etwa 6 bis 8 m² pro kWp installierter Leistung. Für eine Anlage mit 6 kWp wird daher eine nutzbare Dachfläche von 40 bis 50 m² benötigt. Dabei müssen jedoch Abstände zu Dachrändern, Schornsteinen und Dachfenstern eingehalten werden, was die nutzbare Fläche einschränken kann.
Auch Verschattungen durch Bäume oder umliegende Gebäude können die Leistung erheblich beeinträchtigen. Bereits 10 % Verschattung können den Ertrag um bis zu 50 % reduzieren, es sei denn, es werden Optimierer eingesetzt.
Die Dachausrichtung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Süddächer liefern den höchsten Ertrag pro Modul, während Ost-West-Dächer mehr Module aufnehmen können, jedoch pro Modul geringere Erträge erzielen. Bei Ost-West-Ausrichtung wird etwa 20 % bis 30 % mehr Modulfläche benötigt, um denselben Jahresertrag zu erreichen.
Auf Flachdächern müssen die Module aufgeständert werden, was den Platzbedarf auf etwa 10 bis 12 m² pro kWp erhöht. Der Vorteil ist jedoch, dass Module auf Flachdächern optimal ausgerichtet werden können, was den spezifischen Ertrag verbessert.
Dacheignung und rechtliche Voraussetzungen prüfen
Bevor Sie sich für die Installation einer Photovoltaikanlage entscheiden, sollten Sie sowohl die baulichen Gegebenheiten als auch die rechtlichen Anforderungen genau unter die Lupe nehmen. Eine sorgfältige Analyse kann Ihnen später unnötigen Aufwand und zusätzliche Kosten ersparen. Hier finden Sie die wichtigsten technischen und rechtlichen Aspekte auf einen Blick.
Dachausrichtung, Neigungswinkel und Verschattung berücksichtigen
Die Ausrichtung Ihres Daches ist ein entscheidender Faktor für die Effizienz Ihrer Solaranlage. Süddächer liefern in der Regel die besten Ergebnisse, aber auch Dächer mit einer südöstlichen oder südwestlichen Ausrichtung erzielen nahezu vergleichbare Erträge. Dächer, die nach Osten oder Westen zeigen, schneiden hingegen weniger gut ab.
Auch der Neigungswinkel Ihres Daches spielt eine wichtige Rolle. Ein moderater Winkel ist optimal, wobei Flachdächer besonders flexibel sind: Hier können die Solarmodule unabhängig von der Dachneigung optimal ausgerichtet werden.
Ein weiterer Punkt ist die Verschattung. Schatten durch Bäume, Nachbargebäude, Schornsteine oder andere Hindernisse kann den Energieertrag Ihrer Anlage deutlich verringern. Dies gilt besonders für die Morgen- und Abendstunden, wenn die Sonneneinstrahlung am stärksten ist. Nutzen Sie Tools wie das Sonnendach-Tool des Bundesamts für Energie oder lassen Sie eine professionelle Verschattungsanalyse durchführen, um mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen.
Während diese technischen Faktoren die Effizienz Ihrer Anlage beeinflussen, sind die rechtlichen Rahmenbedingungen ebenso wichtig.
Rechtliche Vorgaben in der Schweiz
Die Installation von Photovoltaikanlagen unterliegt in der Schweiz kantonalen und kommunalen Bauvorschriften. In vielen Fällen sind Aufdachanlagen auf bestehenden Gebäuden bewilligungsfrei, vorausgesetzt, sie ragen nicht deutlich über die Dachfläche hinaus und verändern das Erscheinungsbild des Gebäudes nicht wesentlich.
Trotzdem müssen die meisten Anlagen bei der Gemeinde gemeldet werden – und zwar vor Baubeginn. Dabei werden Informationen zur geplanten Leistung der Anlage, zum Installateur und zur Einspeisung ins Stromnetz angegeben. Denkmalgeschützte Gebäude unterliegen oft strengeren Vorschriften, die zusätzliche Genehmigungen erforderlich machen.
Für Freiflächen- oder Fassadenanlagen ist in der Regel eine Baubewilligung notwendig. Diese Anlagen müssen den örtlichen Bauvorschriften entsprechen und dürfen keine unzumutbaren Beeinträchtigungen wie Blendungen oder Störungen in der Nachbarschaft verursachen. Die Bearbeitungszeit solcher Bewilligungen kann mehrere Wochen dauern.
Auch der Netzanschluss und die Einspeisevergütung sollten frühzeitig mit dem lokalen Energieversorger abgestimmt werden, um einen reibungslosen Übergang in den Betrieb zu gewährleisten. Häufig profitieren Betreiber von Vergütungsmodellen oder können den erzeugten Strom zu aktuellen Marktpreisen verkaufen.
Dachtypen und ihre Eignung für Photovoltaikanlagen
Nicht jedes Dach ist gleich – verschiedene Dachtypen erfordern unterschiedliche Montagesysteme und bringen individuelle Vor- und Nachteile mit sich. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick:
| Dachtyp | Eignung | Montageaufwand | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Ziegeldach | Sehr gut | Mittel | Standard-Dachhaken sind bewährt und leicht einsetzbar |
| Blechdach | Sehr gut | Niedrig | Direkte Befestigung ohne Durchdringung der Dachhaut |
| Flachdach | Gut | Mittel | Erfordert Aufständerung, ermöglicht flexible Ausrichtung |
| Schieferdach | Gut | Hoch | Spezielle Befestigung nötig, höherer Installationsaufwand |
| Reetdach | Eingeschränkt | Sehr hoch | Strenge Brandschutzauflagen, besondere Genehmigungen erforderlich |
| Eternitdach | Eingeschränkt | Hoch | Asbestprüfung empfohlen, oft ist eine Sanierung nötig |
Flachdächer bieten den Vorteil, dass Solarmodule unabhängig von der ursprünglichen Dachneigung optimal ausgerichtet werden können. Allerdings ist hier meist eine spezielle Aufständerung nötig.
Besondere Vorsicht ist bei Eternitdächern geboten. Vor der Installation sollte geprüft werden, ob Schadstoffe wie Asbest enthalten sind. Denkmalgeschützte Gebäude oder solche in Schutzzonen erfordern oft eine individuelle Prüfung der baulichen und rechtlichen Voraussetzungen. Eine sorgfältige Planung ist hier unverzichtbar, um alle Anforderungen zu erfüllen und späteren Problemen vorzubeugen.
sbb-itb-b9f7f9d
Komponenten auswählen und Kosten berechnen
Eine Photovoltaikanlage besteht aus mehreren Bauteilen, die perfekt aufeinander abgestimmt sein müssen. Die Auswahl dieser Komponenten beeinflusst nicht nur die Leistung, sondern auch die Gesamtkosten und die Lebensdauer des Systems. Hier erfahren Sie, wie Sie die passenden Komponenten wählen und die Kosten kalkulieren.
Hauptkomponenten einer Solaranlage
Der Kern jeder Photovoltaikanlage sind die Solarmodule, die Sonnenlicht in Strom umwandeln. Je nach Technologie unterscheiden sie sich in Effizienz, Anschaffungskosten, Haltbarkeit und Optik.
- Monokristalline Module: Diese Module sind besonders effizient und benötigen weniger Dachfläche. Obwohl sie teurer sind, bieten sie eine hohe Leistung – ideal bei begrenztem Platz.
- Polykristalline Module: Eine günstigere Alternative, allerdings mit etwas geringerer Effizienz. Optisch unterscheiden sie sich deutlich von monokristallinen Modulen.
- Dünnschicht-Module: Diese Module sind am preiswertesten, benötigen jedoch viel Platz und haben geringere Wirkungsgrade.
Hier ein Überblick über die Unterschiede:
| Modultyp | Effizienz | Kosten | Lebensdauer | Platzbedarf |
|---|---|---|---|---|
| Monokristallin | Sehr hoch | Höher | Lang | Gering |
| Polykristallin | Mittel | Moderat | Lang | Relativ hoch |
| Dünnschicht | Gering | Günstig | Kürzer | Sehr hoch |
Ein weiterer wesentlicher Bestandteil ist der Wechselrichter, der den von den Modulen erzeugten Gleichstrom in netzkonformen Wechselstrom umwandelt. Hier gibt es verschiedene Typen: String-Wechselrichter sind oft eine kostengünstige Wahl, während Leistungsoptimierer bei Teilverschattungen oder unterschiedlichen Modulausrichtungen ihre Stärken zeigen.
Das Montagesystem muss zur Dachkonstruktion passen. Für Schrägdächer gibt es spezielle Befestigungselemente, während Flachdächer oft von Aufständerungslösungen profitieren. Hochwertige Materialien erhöhen zwar die Kosten, sorgen aber für eine längere Lebensdauer und bessere Wetterbeständigkeit.
Zusätzlich sind Verkabelung, Überspannungsschutz und ein Einspeisezähler erforderlich, um den Betrieb der Anlage sicherzustellen. Nach der Auswahl der Komponenten erfolgt die Kostenberechnung und die Prüfung möglicher Förderungen.
Kostenberechnung und Fördermöglichkeiten
Die Gesamtkosten einer Photovoltaikanlage in der Schweiz hängen von mehreren Faktoren ab: der Grösse der Anlage, den gewählten Komponenten und dem Installationsaufwand. Neben den Kosten für Module, Wechselrichter und Montagesystem spielen auch Zusatzaufwendungen wie die Netzanmeldung oder elektrotechnische Anpassungen eine Rolle.
Es gibt jedoch zahlreiche Förderprogramme auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene, die die finanzielle Belastung senken können. Viele Energieversorger bieten zudem Rückliefertarife an, die zusätzliche Einnahmen generieren. Auch der Eigenverbrauch ist wirtschaftlich attraktiv, da er die Stromkosten senkt.
Die Amortisationszeit einer Photovoltaikanlage variiert je nach Rahmenbedingungen, liegt aber meist innerhalb weniger Jahre. Steigende Strompreise können diesen Vorteil noch verstärken. Regelmässige Wartung und lange Garantiezeiten der Hersteller sorgen ausserdem für Planungssicherheit und einen langfristig stabilen Ertrag.
Schweizer Solarfachkräfte finden und beauftragen
Nachdem Sie Ihre Photovoltaikanlage gründlich geplant haben, steht der nächste wichtige Schritt an: die Auswahl eines qualifizierten Installateurs, der Ihr Projekt fachmännisch umsetzt. Die Installation einer Solaranlage ist komplex und erfordert spezifisches Know-how in den Bereichen Elektrotechnik, Baurecht und Sicherheitsvorschriften. Ein zertifizierter Installateur garantiert nicht nur eine fachgerechte Umsetzung, sondern auch die Sicherheit und Langlebigkeit Ihrer Anlage.
Warum zertifizierte Installateure entscheidend sind
Die Zusammenarbeit mit zertifizierten Fachkräften bietet Ihnen ein hohes Mass an Sicherheit und Qualität. Sie erfüllen strenge Standards, die dazu beitragen, Risiken wie Brände, Stromausfälle oder bauliche Schäden zu minimieren. In der Schweiz bestätigt das "Solarprofi®"-Label von Swissolar, dass ein Installateur über die notwendige Ausbildung, Erfahrung und regelmässige Weiterbildung verfügt [1].
Ein zertifizierter Installateur sorgt dafür, dass Ihre Anlage technisch einwandfrei funktioniert und alle rechtlichen sowie sicherheitsrelevanten Anforderungen erfüllt. Zudem profitieren Sie von umfassenden Garantien auf die erbrachten Leistungen, und im Falle von Problemen können Sie mit einer schnellen Lösung rechnen.
firmafinden.ch: Lokale Experten leicht finden

Die Plattform firmafinden.ch hilft Ihnen, qualifizierte Solarinstallateure in Ihrer Nähe zu finden. Dank standortbasierter Filter können Sie gezielt nach Fachbetrieben in Ihrer Region suchen. Dies spart nicht nur Anfahrtskosten, sondern erleichtert auch die Terminvereinbarung vor Ort.
Als zentrales Online-Verzeichnis für Schweizer Unternehmen bietet firmafinden.ch spezialisierte Suchfunktionen, die auf Solarfachkräfte abgestimmt sind. Anbieterprofile sind entweder kostenlos oder als Premium-Version verfügbar. Premium-Profile bieten oft detailliertere Informationen zu Dienstleistungen, was die Auswahl erleichtert. Nutzen Sie die Plattform, um eine Vorauswahl zu treffen – mit der folgenden Checkliste können Sie die Anbieter abschliessend bewerten.
Checkliste zur Auswahl eines Solarunternehmens
Um den richtigen Installateur für Ihre Solaranlage zu finden, lohnt es sich, die folgenden Punkte zu prüfen:
- Verfügt das Unternehmen über ein aktuelles "Solarprofi®"-Label?
- Können Referenzen und Fotos von abgeschlossenen Projekten vorgelegt werden?
- Gibt es Nachweise über Betriebshaftpflicht- und Gewährleistungsversicherungen?
- Wird ein transparenter und detaillierter Kostenvoranschlag angeboten?
- Welche Service- und Wartungsverträge stehen zur Verfügung?
- Ist das Unternehmen mit den aktuellen Förderprogrammen vertraut?
Achten Sie besonders auf Angebote, die deutlich günstiger erscheinen als der Durchschnitt. Oft verbergen sich dahinter minderwertige Komponenten oder versteckte Kosten. Seriöse Anbieter unterstützen Sie zudem bei der Beantragung von Fördergeldern – ein wichtiger Vorteil, der Ihre Kosten erheblich senken kann.
Planung und Installation Ihrer Schweizer Solaranlage
Sobald die Komponenten ausgewählt sind, steht die detaillierte Planung und Installation Ihrer Solaranlage an. Dafür ist es wichtig, einen zertifizierten Fachbetrieb zu beauftragen. Ein erfahrener Experte analysiert Ihre individuellen Energiebedürfnisse, die geografischen Gegebenheiten Ihres Standorts und Ihre persönlichen Ziele. So wird sichergestellt, dass die Solaranlage perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.
Zusätzlich übernimmt der Fachbetrieb alle administrativen Aufgaben: von der Beantragung von Fördergeldern bis hin zur Einhaltung lokaler Vorschriften. Diese umfassende Unterstützung sorgt dafür, dass Ihre Anlage sicher, gesetzeskonform und optimal für die Zukunft installiert wird.
Die Qualität der verwendeten Komponenten spielt eine entscheidende Rolle. Hochwertige Materialien garantieren nicht nur eine lange Lebensdauer, sondern auch eine solide Rentabilität Ihrer Solaranlage [2].
FAQs
Wie kann ich meinen zukünftigen Stromverbrauch realistisch einschätzen, bevor ich eine Photovoltaikanlage plane?
Um Ihren zukünftigen Stromverbrauch besser einzuschätzen, lohnt es sich, zunächst Ihre letzte Stromabrechnung genauer anzuschauen. Der dort aufgeführte Jahresverbrauch gibt Ihnen eine solide Basis für die Planung. In der Schweiz produziert eine typische Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 10 kWp jährlich etwa 8’000 bis 10’000 kWh Strom – ein hilfreicher Richtwert, um erste Überlegungen anzustellen.
Denken Sie dabei auch an mögliche Veränderungen in Ihrem Energiebedarf. Planen Sie beispielsweise, ein Elektroauto anzuschaffen, oder möchten Sie auf energieeffizientere Geräte umsteigen? Solche Faktoren können Ihren Verbrauch erheblich beeinflussen. Für eine präzisere Einschätzung stehen Ihnen Tools zur Verfügung, die anhand von Faktoren wie Dachfläche, Ausrichtung und Neigungswinkel die potenzielle Stromproduktion berechnen. Mit diesen Informationen können Sie die ideale Grösse Ihrer Solaranlage ermitteln.
Welche rechtlichen Vorgaben muss ich in der Schweiz beachten, bevor ich eine Photovoltaikanlage installiere?
In der Schweiz benötigen die meisten Photovoltaikanlagen, die auf privaten Dächern installiert werden, keine vollständige Baugenehmigung. Stattdessen reicht oft eine einfache Meldung bei der zuständigen Behörde aus. Diese Regelung gilt jedoch nur, wenn die Anlage den örtlichen Vorschriften entspricht. Befindet sich das Gebäude in einem speziellen Bereich, wie etwa einem denkmalgeschützten Gebiet, oder handelt es sich um eine grössere Anlage, kann eine Baubewilligung erforderlich sein.
Ein weiterer wichtiger Punkt: Photovoltaikanlagen müssen die in der Schweiz geltenden Sicherheitsstandards erfüllen, wie beispielsweise die europäischen Installationsvorschriften. Es ist ratsam, sich vor der Installation über die spezifischen kantonalen Regelungen zu informieren. Bei Unsicherheiten hilft ein Gespräch mit der lokalen Baubehörde, um sicherzugehen, dass alle rechtlichen Vorgaben eingehalten werden.
Warum sollte ich meine Solaranlage von einem zertifizierten Installateur planen und installieren lassen?
Die Zusammenarbeit mit einem zertifizierten Installateur bringt klare Vorteile mit sich. Diese Experten sorgen dafür, dass Ihre Solaranlage sorgfältig geplant und installiert wird, was sowohl ihre Effizienz als auch ihre Lebensdauer deutlich steigert. Zudem achten sie darauf, dass sämtliche gesetzlichen Anforderungen und technischen Standards erfüllt werden. Das erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern kann auch den Zugang zu Fördergeldern erleichtern.
Ein weiterer Pluspunkt: Sie erhalten eine Beratung, die genau auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zugeschnitten ist. Damit wird Ihre Investition in eine umweltfreundliche und wirtschaftlich sinnvolle Photovoltaikanlage bestmöglich abgesichert.